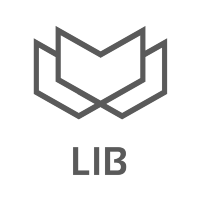PROSA
„Mein Freund, der Baum, ist tot“ *
Noch einmal heulte die Kettensäge auf, fraß sich rasend schnell durch den Fuß des mannshohen Baumstumpfes, dann ein kurzes Rucken am Sicherungsseil und der Rest des einstmals etwa zehn Meter hohen Baumes kippte zur Seite weg in die vorgesehene Richtung.
Den ganzen Vormittag hatten die drei Männer konzentriert gearbeitet, vorsichtig vom Wipfel her abwärts, erst die Äste herausgesägt, dann Stück für Stück den Stamm verkürzt. Die dünneren Äste wurden gleich vor Ort geschreddert und die zerkleinerte Masse auf einen Anhänger geblasen, die restlichen Teile entastet, zersägt und ebenfalls zum Abtransport verladen.
Einen Augenblick hatte es so ausgesehen, als könnte ein größerer Teil des Baumes weiterleben, als brauchte nur ein morscher Bereich entfernt zu werden, wie bei einer Operation, doch als sich herausstellte, dass der Baum weitgängig hohl und brüchig geworden war, musste er aus Sicherheitsgründen ganz heruntergenommen, musste er gefällt werden. Dies berichtete mir, sichtlich erschüttert, unser älterer Nachbar von Gegenüber, der diesen Baum vor ca. dreißig Jahren selbst gepflanzt hatte, eine Asiatische Kirsch-Pflaume, eine Prunus cerasifera. Sie könnte ungefähr 10 m hoch werden, hatte er uns ganz stolz erläutert, als er uns den blühenden Baum im Frühjahr letzten Jahres vorgestellt hatte.
Schon als wir um die Jahreswende davor in unsere neue Wohnung einzogen, war er freundlich auf uns zugekommen und hatte uns im Gespräch mit unserem neuen Zuhause und den neuen Nachbarn vertraut gemacht und fand auch danach immer ein freundliches Wort für uns. Als der Frühling begann, hatte er vormittags bei uns geklingelt, um meiner Frau und mir freudestrahlend den über und über mit rosa Blüten bedeckten Baum – oder sollte man besser sagen Strauch? – zu präsentieren, den das kräftige, nicht enden wollendende Gesumme von Abertausenden Insekten erfüllte, die hier an den gedeckten Tisch eilten, und dem ein kräftig-süßlicher Duft, wie wir ihn ähnlich von blühenden Rapsfeldern kennen, entströmte. Es war atemberaubend schön zu sehen und zu hören und zu riechen, ein lebendiger Zauber. Und unser Nachbar, der uns dieses Wunder vorstellte, stand dabei und strahlte wie ein glücklicher Vater.
Nun, mehrere Monate später, war der Baum abgeblüht, das schier unaufhörliche Gesumme der unzähligen Insekten verstummt und die Zweige über und über mit dunkel-rötlich-violetten Blättern bedeckt. Auf den ersten Blick machte er einen gesunden und kräftigen Eindruck, aber dort, wo die verschiedenen nahezu gleichstarken Äste sich verzweigten und gen Himmel strebten, da war der Baum eingerissen und drohte aus-einanderzubrechen. Ein chirurgischer Eingriff hatte sich als sinnlos erwiesen, der Baum musste gefällt werden, und unser Bedauern und die Betroffenheit desjenigen, der den Baum einst gepflanzt hatte, waren groß. Dann ging es relativ schnell, und ehe der Tag vergangen war, war die Stelle, an der die Asiatische Kirsch-Pflaume bis zum heutigen Tage gewachsen und geblüht hatte, kahl und leergeräumt.
Dies alles geschah im Herbst letzten Jahres, bevor die Herbst- und Winterstürme einsetzten, rechtzeitig genug, bevor sie mit ihrer Gewalt den Baum zerbrechen und vielleicht dann Passanten hätten verletzen können. Der Verstand sagt mir, das es notwendig gewesen war, doch wenn ich nun auf die kahle Stelle blicke, die der wunderschöne Baum einst ausgefüllt hat, zieht Traurigkeit durch meine Gedanken und das Bewusstsein, wie vergänglich doch alle Schönheit dieser Welt ist.
Ein halbes Jahr später, am Abend des 17. Februar 2022, verstarb unser Nachbar völlig unerwartet in seiner Wohnung. Bei einem Gespräch mit seiner Frau stürzte er schlagartig zu Boden, so wie ein Baum, der gefällt wird, ohne vorherige Anzeichen, ohne vorangegangene Krankheit, einfach so. Sechsundachtzig Jahre war er alt geworden.
Auch er fehlt uns nun.
16.05.2022
*Lied der Sängerin Alexandra von 1968
Ach, wie gut, dass niemand weiß…
…, dass ich Rumpelstilzchen heiß!“ freut sich das geheimnisvolle Männlein in einem Märchen der Gebrüder Grimm, das ich seit frühen Kindertagen kenne. Ich heiße natürlich nicht Rumpelstilzchen und bin auch gar nicht so froh darüber, dass niemand weiß, wie ich heiße.
Seit nahezu sechzig Jahren schreibe ich Gedichte, und vor siebzehn Jahren begann ich auf Anregung eines älteren Herren, der mit Gedichten nicht so recht was am Hut hatte, kurze Geschichten aller möglicher Art zu verfassen, Glossen, Märchen, Krimis, autobiographische Texte and anderes mehr. Aber ich finde, dass mein Oeuvre nicht die Verbreitung und Anerkennung findet, die ihm angemessen wäre. Hin und wieder stelle ich Auswahlbände zusammen, die ich im Eigenverlag in Auflagen von maximal 30 Stück herausgebe und dann meist an Interessierte und Familienangehörige verschenke. Ich habe es mal kommerziell versucht, doch der Verkauf ging nur schleppend, zutiefst enttäuschend! Wie es scheint, ist die Welt noch nicht reif für meine Werke.
Vielleicht liegt es aber auch daran, dass mein Name nicht so bekannt ist, wie er aus Geschäftsgründen sein könnte und müsste. Als einen ersten Schritt auf dem Wege zum Erfolg habe ich meinen Taufnamen „Karl-Friedrich Eberhard Rose“ schon ein wenig gekürzt auf „Karlfried Rose“, „Karlfried“ wie seinerzeit „Karlfried Graf Dürckheim“. Nicht ganz ohne eine gewisse Berechtigung, denn mein lieber, stolzer Papa wollte den Namen seines ersten Sohnes beim Standesamt gerne als „Karlfried“ eintragen lassen, doch das wurde ihm von dem dortigen Hoheitsträger preußisch kurzangebunden verwehrt: Den Namen gäbe es nicht im Register der amtlich zugelassenen arischen Vornamen! Und so hieß ich amtlicherseits von da an: (siehe oben!), aber in der Familie scherte man sich nicht darum, und dort hieß ich „Karlfried“ – wie der gleichnamige, aber Sie wissen ja schon! - zumindest nachdem das schmeichelnde, liebevolle „Bubi“ altersmäßig nicht mehr ganz angemessen war.
Aber auch dieser „Künstlername“ brachte mir nicht den gewünschten Erfolg bei den potenziellen Lesern und Bewunderern meiner Schriften. Also überlege ich nun angestrengt, wie ich den Autorennamen gestalten könnte, damit er sich besser verbreitet.
Bei meinen Forschungen stieß ich auf drei weitere Möglichkeiten, wie der Name publikumswirksam verändert werden könnte. Eine Möglichkeit, die mir aber etwas zu exotisch zu sein scheint, mich daher nicht so recht begeistert, wäre, einen möglichst ausgefallenen Fantasienamen zu wählen, der die Menschen zum Herumrätseln bringt: Wer könnte sich denn hinter diesem Aliasnamen verstecken? Was hat es auf sich mit dem Namen, was soll er bedeuten, welche geheimnisvolle Botschaft will er verbreiten? Aber das wäre nichts rechtes für mich, obgleich - ein Politiker aus Lübeck, der seinen Namen von Herbert Ernst Karl Frahm in Willy Brandt änderte, erhielt später sogar den Nobelpreis. Dagegen ist ein anderer Politiker aus Georgien mit dem Namen Iosseb Vessarionowitsch Dschugaschwili, eher unter seinem Kampfnamen Stalin, „der Stählerne“, bekannt, kein so leuchtendes Beispiel. Nein, dann lieber doch nicht!
Eine weitere Möglichkeit wäre, unbeliebte, umständliche oder veraltete Vornamen ganz einfach mit einem Großbuchstaben samt Punkt dahinter, besser noch wären zwei geheimnisvolle Großbuchstaben samt Punkt dahinter, abzukürzen und vor den Familiennamen zu stellen: Der deutsche Schauspieler Otto Eduard Hasse nannte sich ab 1939, als er ein Engagement in Prag annahm, einprägsam nur noch O. E. Hasse und wurde unter diesem Namen noch bekannter. „K. F. E. Rose“ klingt schon interessanter, nicht wahr, das sind sogar drei geheimnisumwitterte Vornamenskürzel. Wenn ich dagegen meine Kose- und Spitznamen wählte, hieße das dann „B. O. Rose“. Vielleicht wäre das noch geheimnis- und wirkungsvoller, nicht wahr? Aber dann müsste ich eines Tages vielleicht verraten, was sich hinter dem „O.“ verbirgt, also lasse ich es wohl lieber.
Eine dritte Möglichkeit dachte sich der Schriftsteller (aha!) Kurt Wilhelm Marek aus: Zum ersten kürzte auch er seine Vornamen vornehm ab, das heißt, aus dem „Kurt“ wurde kein gewöhnliches „K.“, sondern ein edleres „C.“, und dann wandelte er seinen Namen zu einem Ananym, d. h. er drehte ihn einfach um und nannte sich von nun an „C. W. Ceram“, angeblich um sich von seinen früheren Werken abzusetzen…
Langer Rede kurzer Sinn: „K. F. Esor“, wäre das nicht ein toller Künstlername, der sich in Windeseile über den Globus verbreiten könnte? Ich sehe schon, wie mir die Verlage meine neuen Werke aus den Händen reißen und die Auflagen in ungeahnte Höhen schnellen.
Aber träumen werde ich doch wohl noch dürfen, oder?
P. S.:
Als meine liebe Frau, die als Haus- und Hofkritikerin alle meine neuentstandenen Gedichte und Geschichten als erste liest, diesen Text studiert hatte, fiel ihr noch eine weitere Namenvariante ein: ein Anagramm. Hierbei verändert man die Buchstaben oder Silben in beliebiger Reihenfolge. Ein Anagramm des Familienamens „Rose“ wäre z. B. „Eros“, zwar kein deutsches, sondern ein griechisches Wort.
Aber welche Bedeutung, welche Bedeutung!!!
21.02.2022
Wolfhard
„Ehrwürdiger, was wirst Du uns heute für eine Geschichte erzählen? Handelt sie von Liebenden, die erst viele Hindernisse überwinden müssen, bis sie einander umarmen dürfen, oder von Freunden, die auf der Suche nacheinander sind? Erzählst Du uns von einem Menschen, der den Sinn seines Lebens finden möchte? Oder berichtest Du uns von denen, die gegen Gewalt und Ängste ankämpfen, um ihren Lebensmut wiederzufinden? Also, was wirst Du uns dieses Mal erzählen? Spann uns bitte nicht so sehr auf die Folter, wir können es kaum erwarten...“.
„Die Geschichte, von der ich Euch heute berichten werde, ereignete sich schon vor sehr, sehr langer Zeit. Mein Vater hatte sie von seinem Vater erfahren, der wiederum von dem seinen und so weiter und so fort. Diese Kette reicht unendlich lange zurück, so dass wir heute nicht mehr wissen, wer zum ersten Mal davon erfahren hat.
Es war einmal ein Junge, der Benjamin hieß. Mitten in der Nacht wurde er von einer Stimme geweckt, die ganz eindringlich um Hilfe rief. Er schüttelte sich, so wie es junge Hunde morgens tun, um sich die Träume der Nacht aus dem Fell zu schütteln, und versuchte einen halbwegs klaren Gedanken zu fassen. Wer um alles in der Welt sollte ihn mitten in der Nacht rufen? Ihn? Ja, ganz gewiss ihn, denn er hatte laut und deutlich seinen Namen gehört. Laut und deutlich? Wenn das der Fall gewesen wäre, müssten doch seine beiden Brüder, die mit ihm im gleichen Zimmer schliefen, auch davon wach geworden sein, aber die schnarchten kräftig weiter. Gewiss war das nur so ein alberner Traum gewesen, der ihm einen Schabernack spielen wollte. Am besten wäre es, sich überhaupt nicht davon beeindrucken zu lassen. Benjamin drehte sich auf die andere Seite und versuchte wieder einzuschlafen. Fast hätte er es geschafft, sich wieder in Morpheus Arme fallen zu lassen, da rief ihn die Stimme zum zweiten Mal. Hatte er das doch nicht nur geträumt? Wer könnte das sein, der ihn zur Hilfe rief, ausgerechnet ihn, den jüngsten der Geschwister? Warum rief die Stimme nicht Max, den ältesten und stärksten, der es mit allen Streithähnen im Dorf aufnehmen könnte, wenn es sein müsste? Schon eine merkwürdige Sache, dachte er, aber nun war er wirklich wach, und die Stimme rief immer noch nach ihm, rief ihn beim Namen: „Benjamin, bitte hilf mir!“.
Benjamin begriff, dass er das Rufen nicht mit seinen Ohren, sondern nur in seinem Innern, in seinen Gedanken hörte, ein Rufen, das nur für ihn, den kleinsten und unscheinbarsten der Geschwister bestimmt war. Und er wusste, dass er diesem Ruf folgen musste, nein, dass er ihm folgen wollte. Irgendjemand rief ihn, ausgerechnet ihn, keinen stärkeren und klügeren, sondern ihn. Und wenn dieser Jemand ihn zur Hilfe rief, dann musste er doch irgendetwas an sich haben, was ihn von allen anderen unterschied, etwas, was ihn allein dazu befähigte. Das war etwas ganz Neues für ihn und verwirrte ihn. Nach einem Augenblick des Erstaunens antwortete Benjamin: „Ich bin bereit, Dir zu helfen, auch wenn ich es mir im Augenblick nicht vorstellen kann, wie das gehen sollte. Aber Du wirst schon wissen, was Du vorhast. Sage mir, was ich tun soll, ich bin bereit!“
„Denke daran, wie kühl die Nächte noch sind, und ziehe Dich bitte warm an. Nimm Dir auch etwas zu essen und zu trinken mit, denn der Weg ist lang und wird Dich erschöpfen. Dann tritt aus dem Haus und folge Deinem Gefühl, es wird Dich zu mir führen!“.
Benjamin tat, wie ihm die Stimme gesagt hatte, und machte sich auf den Weg. Stunde um Stunde verging. Unterwegs aß er ein paar Bissen und trank einen Schluck Wasser, doch vermied er es, sich hinzusetzen, weil er befürchtete, er könnte wieder einschlafen und zu spät kommen, um zu helfen.
Als er an eine Wegkreuzung gelangte, auf der sich sechs verschiedene Wege aus allen Himmelsrichtungen trafen, wusste er nicht mehr weiter. Doch die innere Stimme ermutigte ihn: „Höre nur auf das, was Dein Herz Dir sagt, so wirst Du nicht fehlgehen!“. Er spürte, dass eine unsichtbare Kraft ihn bestärkte, dem Wege geradeaus weiter zu folgen, und ruhig setzte er seinen Marsch fort.
Schon hatte die Sonne ihren höchsten Stand überschritten und der Abend war nicht mehr fern, als er die Stimme wieder vernahm: „Wenn Du um die Wegbiegung dort vor Dir kommst und Dich dann dem Waldrand näherst, wirst Du mich sehen können.“
Benjamin eilte voran, um dann wie vom Schlage getroffen mitten im Schritt zu erstarren. Vor ihm in einer tiefen Grube, die vorher mit grünen Zweigen abgedeckt gewesen war, saß ein großer, kräftiger Wolf. An den tiefen Kratzspuren konnte er erkennen, dass jener verzweifelt, aber vergeblich versucht hatte, die senkrechten, glatten Wände zu erklimmen, um sich aus seinem Gefängnis zu befreien. Benjamin nahm all seinen Mut zusammen und fragte: „Bist Du es, der mich um Hilfe gerufen hat? Und wenn Du es bist, wie könnte ich Dir helfen?“.
Der Wolf knurrte nur leise vor sich hin, aber Benjamin vernahm ganz klar und deutlich: „Danke, Benjamin, dass Du gekommen bist. Ja, ich habe Dich gerufen. Ich kenne Dich, ich habe Dir oft beim Spiel mit anderen Kindern zugesehen, auch wenn Du mich nicht bemerkt hast. Wir sehen vieles, was Euch Menschen verborgen bleibt. Ich wusste, Dein gutes Herz würde Dich zu mir führen und Dir den Mut und Verstand geben, um mir zu helfen. Suche starke Äste oder etwas Ähnliches und lasse sie zu mir herab. Mit ihrer Hilfe werde ich aus der Grube herausklettern können. Und habe keine Furcht, Dir wird nichts geschehen“.
Gesagt, getan. Schon kurze Zeit später konnte sich der Wolf mit Benjamins Unterstützung aus der Grube befreien. Dankbar leckte er ihm die Hand und drückte sich Nähe suchend an ihn.
„Heute hast Du mir das Leben gerettet, das werde ich Dir niemals vergessen. Wenn Du eines Tages meine Hilfe brauchst, rufe mich, ich werde kommen. Rufe mich einfach mit Deinen Gedanken, ich werde Dich überall hören, so wie Du mich heute gehört hast.
Deine Eltern haben Dir einen wunderschönen Namen gegeben. Sie nannten Dich Benjamin, das heißt: Kind der Freude. Doch von heute an sollst Du einen zweiten Namen tragen. Ich nenne Dich Wolfhard, denn Du bist „tapfer wie ein Wolf“, mein Sohn.“
20.01.2014
Wie war Dein Tag, Schatz?
Eduard konnte sich nun schon einige Jahre des wohlverdienten Ruhestandes erfreuen, den er nach rund vierzig Berufsjahren einigermaßen gesund und munter erreicht hatte. Wie hatte er sich doch auf diese Zeit gefreut, in der er frei von Zeitzwängen und Dienstanweisungen endlich seinen Interessen nachgehen könnte. Nun würde er die Zeit finden, all die Bücher zu lesen, die er und seine Frau im Laufe der vielen Jahre erworben hatten. Wenn ihn eine Fernseh- oder Rundfunksendung interessierte, müsste er nicht mehr mit schlechtem Gewissen auf die Uhr sehen, könnte Gespräche, die ihm wichtig wären, so lange verfolgen, wie es ihm gefiele, und Bücher, die ihn fesselten, genüsslich auch noch um drei Uhr morgens zu Ende lesen. Niemand hetzte ihn mehr, kein Wecker schrillte und jagte ihn in stockdunkler Nacht aus dem mollig-warmen Bett, das wäre nun alles vorbei! Paradiesische Zeiten würden hereinbrechen und sein Leben eitel Freude und Sonnenschein sein, - hatte er sich damals gedacht, erhofft und erträumt.
Doch wie heißt es so schön? Irgendjemand sorgt schon dafür, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen, dass kein hemmungsloses Chaos ausbricht im vermeintlichen Garten Eden. Und im Zweifelsfalle ist dieser Jemand die liebende Ehefrau, die sich darum kümmert, dass der nun arbeitslose Lebensgefährte nicht ziellos in der Gegend umherirrt, sich etwa langweilt und vielleicht dann noch trübsinnig wird: Schon gleich nach dem Aufwachen bleibt ihm der Morgenkaffee im Halse stecken, wenn sie ihm eröffnet, welche Freizeitbeschäftigungen seiner am heutigen Tage harren. Es kommt infolgedessen schon einmal vor, dass Eduard sich voller Sehnsucht der guten, alten Zeiten seines Berufslebens erinnert.
Er kann sich nunmehr stets darauf verlassen, dass sie sich wirklich Gedanken macht, was er alles so an diesem Tage erledigen könnte, wobei sie nicht selten die spitze Bemerkung fallen lässt: „Eigentlich könntest Du ja auch selber darauf kommen! Aber wenn man sich darauf verlassen wollte...“. Wobei diese Frau überhaupt nicht in Erwägung zieht bzw. ziehen will, dass Eduard eine etwas andere, eben nicht ganz so enge Sicht der Dinge hat wie sie und in der Gelassenheit des Alters alles etwas ruhiger angeht.
Hat er sich für diesen Tag etwa einmal vorgenommen, geruhsam in einem Buch zu lesen oder einen ausgedehnteren Spaziergang oder eine Fahrt in die nahegelegene Stadt zu unternehmen, sieht der heutige Dienstplan Wäschewaschen und Generalreinigung der Wohnung vor, wobei sie ihm dann haarklein auflistet, auf was er alles zu achten hätte. „Und setze doch bitte mal die Brille auf, wenn du sauber machst, und denk auch an die Ecken. Dafür nimm bitte die spitze Düse, da kommst du mit der breiten nicht hin, sonst bleibt der Dreck wieder liegen!“ usw. usw. Und Eduard darf sich hundertprozentig darauf verlassen, dass sie nach ihrer Rückkehr aus dem harten Berufstag dennoch Zeit finden wird, sich davon zu überzeugen, ob er ihre wohlgemeinten Ratschläge auch befolgt hat. Gegebenenfalls wird sie ihn zart darauf hinweisen, wo etwas seiner beschränkten Aufmerksamkeit entgangen sei. „Wenn man denn nicht alles selber macht!“.
Falls und wenn er dann nach des Tages Müh und Plag endlich doch einmal Zeit für ein Buch findet und auf geruhsame und entspannte fünf Minuten hofft, ja, sich regelrecht darauf freut, kreuzt sie mit Sicherheit gerade dann auf, betrachtet ihn mit spöttisch-vorwurfsvollem Blick und seufzt: „So gut wie du möchte ich’s auch mal haben!“.
19.09.2010
Nacht der Entscheidung
Die Szene erinnerte Max an einen der zahlreichen Historienfilme, die er in seinem Leben gesehen hatte: Der Marktplatz einer mittelalterlichen Stadt, umgeben von vornehmeren Bürgerhäusern, dem steinernen Rathaus und der ihm gegenüber gelegenen, zweitürmigen Stadtkirche. In der Mitte des kopfsteingepflasterten Platzes ragte der furchterregende, hölzerne Aufbau des Blutgerüstes über die Köpfe der sensationslüsternen Menge, die die Richtstätte dichtgedrängt umstand. Wie es üblich war an den Gerichtstagen, wurde das Urteil sogleich vor aller Augen vollstreckt, und es gab immer etwas zu sehen. Der Verurteilte wurde herangeführt, kniete vor dem Richtklotz nieder, und bevor er den Kopf senkte, blickte er noch einmal fragend zum Scharfrichter auf, der in seiner roten Robe drohend vor ihm stand. Dessen Gesicht war verhüllt, nur dunkle Augen blickten eher gleichgültig auf das Opfer. Ein letzter Funke von Hoffnung erlosch im Antlitz des Delinquenten, und ergeben neigte er sein Haupt.
Der Henker griff hinter sich und zog das gewaltige Richtbeil unter den Lumpen hervor, die es bisher vor den Blicken aller verborgen hatten. Er erfasste es mit beiden Händen, suchte einen sicheren Stand und erhob das Beil hoch über seinen Kopf empor. Einen Augenblick später würde er es mit ganzer Kraft zielgenau herab sausen lassen und den Kopf vom Rumpf trennen.
Die Sicht der Dinge verschob sich: War Max bisher ein unbeteiligter Zuschauer gewesen, nahm er im nächsten Augenblick den Vorgang mit den Augen des Scharfrichters wahr. Er spürte das Gewicht der messerscharfen Axt in den zum Schlag erhobenen Armen, sah den entblößten Hals des Verurteilten vor sich und wusste, dass er töten würde. Der vor ihm Kniende hatte den Tod verdient, das Gericht hatte ihn nach Recht und Gesetz zur Rechenschaft gezogen und für schuldig befunden, und der Henker führte lediglich dieses Urteil aus. Außerdem war es nicht das erste Mal, dass er tätig wurde, und noch nie hatte er dabei Skrupel empfunden. Er vollzog nur den Urteilsspruch, den andere zu verantworten hatten, die das Richteramt bekleideten und gebildeter waren als er. Aber er konnte den Blick nicht vergessen, mit dem jener zu ihm aufgesehen hatte.
Schweißgebadet wachte er aus seinen Albträumen auf. Lange dauerte es, bis er sich beruhigte und wieder einschlafen konnte, und als ihn morgens um sechs Uhr der Wecker hochjagte, fühlte er sich müde und ausgelaugt.
Max Kliemann war Inhaber eines mittelständischen, metallverarbeitenden Betriebes im Umkreis einer größeren Stadt, der recht und schlecht über die Runden kam. Manche seiner Mitarbeiter waren schon bei seinem Vater beschäftigt gewesen und hatten mit ihrer Fachkompetenz dem Unternehmen den guten Ruf erworben, den es heute noch besaß. Doch die Zeiten hatten sich geändert, die Aufträge sprudelten nicht mehr so zahlreich, die Konkurrenz war größer und aggressiver geworden, und er musste wirklich mit spitzem Stift rechnen. Um über die Runden zu kommen, konnte er sich keine Sentimentalitäten mehr leisten. Er musste einen kühlen Kopf behalten, wenn Kliemann Metallform GmbH und Co KG überleben sollte.
Heute Morgen stand ihm eine äußerst unangenehme Aufgabe bevor: Er musste einem verdienten Mitarbeiter sein Kündigungsschreiben aushändigen. So etwas wurde in seinem Betrieb nicht anonym per Post zugestellt, das erledigte der Chef selber.
Gerd Baumann hatte zusammen mit ihm in der Firma gelernt. Er erinnerte sich noch genau an die erfolgreich durchgestandene Lehre und Gesellenprüfung und auch daran, wie Gerd zusammen mit ihm die Meisterkurse der IHK besucht hatte, die dieser, wie er neidlos zugestehen musste, sogar mit einer besseren Note als er beendet hatte. An dem Abend hatten sie mal so richtig einen drauf gemacht, und der Alte und Gerds Eltern freuten sich von Herzen über den Erfolg der beiden. Das Leben ging weiter: Sie beide lernten fast zur gleichen Zeit ihre späteren Frauen kennen, und bald danach gründeten sie ihre Familien. Die Verbindung hielt, auch als sich der Alte zurückzog und der Sohn die Leitung des Betriebes übernahm. Er wusste, er konnte sich hundertprozentig auf Gerd verlassen. Wenn er außerhalb des Betriebes um Aufträge kämpfte, lief in der Firma alles wie gewohnt weiter. Gerd hielt ihm den Rücken frei und sorgte mit seiner Fachkompetenz und absoluten Zuverlässigkeit dafür, dass die Vorrichtungen und anderen Werkstücke fristgerecht und in verlangter Qualität an die Kunden ausgeliefert werden konnten. Das ging natürlich nicht ohne Überstunden ab, aber das Gehalt stimmte, und schon bald konnte die wachsende Familie daran denken, ein eigenes Haus zu bauen. Manchmal bedauerte Gerd es zwar, dass er nicht mehr Zeit für Frau und Kinder aufbringen konnte, aber er tröstete sich ein wenig mit der Gewissheit, dass er gut für sie sorgen konnte.
Vor zwei Jahren hatte Gerd dann einen Schicksalsschlag hinnehmen müssen, von dem er sich bis heute nicht erholt hatte: Bei seiner Frau wurde Bauchspeicheldrüsenkrebs festgestellt und - wie meist bei dieser Krankheitsform - erst, als es schon zu spät zu einer wirksamen Hilfe war. Zwar waren die Kinder inzwischen aus dem Gröbsten heraus und konnten schon ganz gut allein zurechtkommen, aber Gerd vermisste seine Frau unsäglich. Mit ihrer ruhigen und ausgleichenden Art hatte sie seinen beruflichen Einsatz erst möglich gemacht, für ein Zuhause gesorgt, in das er gerne heimkam, und sich immer die Zeit genommen, um ihm zuzuhören und mit ihm zu sprechen, wenn er ihren Rat und Zuspruch benötigte. Er hatte das Gefühl, in ein tiefes, schwarzes Loch gefallen zu sein, aus dem es kein Entrinnen gab. Die Freunde, allen voran Max Kliemann und seine Frau, kümmerten sich rührend um ihn, doch nichts konnte ihn trösten, nichts den Verlust ertragen helfen.
Irgendwann wirkte sich das auch auf seine Arbeit aus. Die Fehler nahmen zu, Kunden beschwerten sich zunehmend über nichteingehaltene Termine, und erste Aufträge brachen weg. Max überlegte, wie er Gerd zumindest vorübergehend entlasten könne, aber der wehrte sich mit Händen und Füßen gegen diese „Demontage“ und versprach Besserung. „Ich kriege das schon wieder in den Griff. Wir haben doch bisher erfolgreich zusammengearbeitet, das wird auch weiter möglich sein. Ich reiße mich schon zusammen, das verspreche ich dir.“ Aber die Probleme wurden nicht geringer, und Max wurde den Verdacht nicht los, dass sein alter Kumpel vermehrt zur Flasche griff.
Es blieb ihm nichts anderes übrig, als selber einen Teil der Verantwortung für die Produktion zu übernehmen, und Gerd einen jüngeren, vielversprechenden Techniker zur Seite zu stellen. Als es dann öfters dazu kam, dass Gerd mit Alkoholfahne und verspätet zur Arbeit erschien, war Max‘ Geduld irgendwann erschöpft: Er führte noch einmal ein längeres, eindringliches Gespräch mit Gerd und stellte ihm wenig später eine schriftliche Abmahnung zu. Das enge Verhältnis zwischen beiden hatte tiefe Risse bekommen, die nicht mehr zu übersehen waren.
In der Folgezeit nahm die Fahrt in den Abgrund an Geschwindigkeit zu, und heute Morgen würde er Gerd die Kündigung überreichen müssen. Er würde sich nicht darum drücken und einen anderen vorschicken, dazu kannten sie sich zu lange. Er war überzeugt, dass sie sich trennen müssten, bevor noch mehr Schaden angerichtet würde. Vielleicht hätte Gerd noch eine Chance gehabt, wenn er sich ärztliche Hilfe geholt hätte. Auch jetzt wäre bestimmt noch etwas zu retten, wenn Gerd es denn nur wollte. Aber Max hatte die Verantwortung für das Gedeihen des Betriebes und eine Familie, für die er sorgen musste.
un war es soweit: Gerd stand vor ihm mit gesenktem Kopf und hängenden Schultern, denn er wusste, was nun geschehen würde. Er hatte Angst davor und auch vor dem, was danach auf ihn zukommen würde. Er sagte kein Wort, denn er wusste, wie lange Max diesen Schritt hinausgezögert hatte, und auch, dass er alles Recht dazu hatte. Dann hob er den Blick, um den Urteilsspruch entgegen zu nehmen.
Als Max die traurigen Augen in dem grauen, abgemagerten Gesicht seines Freundes sah, die sich auf ihn richteten, war schlagartig alles wieder gegenwärtig: Er spürte die Schwere der messerscharfen Axt in den zum Schlag erhobenen Armen, sah den entblößten Hals des Verurteilten vor sich auf dem Richtblock und wusste, dass er töten würde.
22.05.2009